Die Griffe sind gar nicht sooo klein, aber die abdrängende Wand, die schlechten Tritte und der sich weiter entfernende Haken erhöhen sekündlich den Druck auf den Unterarmen: Obwohl viele Routen im Franken gar nicht so furchtbar lang sind, ergibt sich aus dem Charakter der Kletterei mit vielen Metern im überhängenden Gelände eine verhältnismäßig ausgeprägte Anforderung an die Kraftausdauer. Bei tickender Uhr noch präzise und kraftvolle Kletterzüge hinzulegen, ist somit das Herz der fränkischen Kletterei.
Es liegt in der Natur der Sache: In schweren Routen müssen wir unsere Fingermuskulatur anhaltend einsetzen. In den fränkischen Überhängen warten nur selten gute Ruhepunkte, entsprechend intensiv ist die Belastung für die Unterarme, die Konsequenz: Wir fühlen uns gepumpt. Klettern im Frankenjura ist im wesentlichen eine Kraftausdauerbelastung.
Auf der körperlichen Ebene ist das Problem dabei: Wenn viele Muskelfasern bei der Arbeit sind (kontrahieren), kann kaum mehr Durchblutung stattfinden. Dies passiert ab einer Intensität von circa 50 Prozent der vorhandenen Maximalkraft. Während Kletterzügen dieser Intensität gelangt also weder frischer Sauerstoff zum Muskel, noch können Stoffwechselprodukte abgebaut werden. Darauf reagiert die Muskulatur mit verringertem Output. Daher bleiben nur die Optionen, zum einen die Muskulatur der Unterarme physiologisch zu trainieren, zum anderen die Faktoren zu bearbeiten, die die ganze Angelegenheit noch anstrengender machen (z.B. schlechte Technik oder Angst).
Hier erläutern wir die besten Methoden, wie man den steigenden Sog der Schwerkraft minimiert und die Widerstandskraft der Fingermuskeln erhöht.
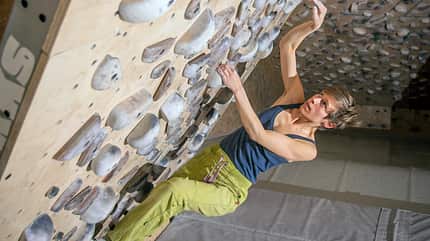
Kraftausdauertraining: 5 Methoden
Pumpige Routen klettern
Wenn man sich regelmäßig in pumpige Routen begibt und kürzere sowie mittellange Routen mit hoher Intensität klettert, wird man einen gewissen Trainingseffekt spüren. Laut Trainingsexperte Dr. Guido Köstermeyer fällt dieser jedoch geringer aus, als beim gezielten Training (siehe weitere Methoden unten). Die gute Nachricht ist allerdings: Einfach am Fels oder in der Halle im Wechsel mit dem Partner relativ anstrengende Routen klettern, stellt im Prinzip schon eine Art Intervalltraining dar. Dazu klettert man Routen mit relativ hoher Belastung bei unvollständiger, also eher kurzer Pause.

ARC Training / Dauermethode
Bei der Dauermethode klettert man mindestens 20 Minuten am Stück, und steigert sich über mehrere Einheiten bis zu 30 Minuten Kletterzeit. ARC steht dabei für "aerobic respiration and capillarity", d.h. man trainiert in dem Bereich, den Sportwissenschaftler aerob nennen und der gerade noch so leicht ist, dass man nicht in Pump gerät, sondern unter leichter Anstrengung weiterklettern kann. Die Intensität liegt dabei ungefähr ein bis zwei volle Schwierigkeitsgrade unter dem Onsightniveau, also klettere ich beispielsweise 9-, dann sollte ich für die Dauermethode ungefähr im siebten Grad bleiben. Diese Belastungsform hat sich als am effektivsten erwiesen, um eine verstärkte Kapillarisierung der Muskulatur zu hervorzurufen, also für mehr Blutgefäße zu sorgen. Mehr Blutgefäße bedeuten eine verbesserte Durchblutung, und ergo einen verbesserten Energiestoffwechsel. Man sollte mindestens 8, besser 12 oder idealerweise bis zu 18 Sessions über 2 bis 4 Wochen einplanen. Diese Dauereinheit lässt sich auch vor den nächstgenannten Methoden zum Einklettern nutzen.
4x4 Bouldertraining
4x4 heißt, vier Boulderprobleme mit sehr kurzen Pausen dazwischen (20 Sekunden) vier mal hintereinander weg zu klettern. Nachdem die vier Boulder erstmals geklettert sind, folgen 3 bis 5 Minuten Pause, danach die nächste Runde in den vier Bouldern, und dann das ganze noch zwei Mal. Die Schwierigkeit der Boulder sollte so sein, dass du die Boulder in der letzten Runde nur noch knapp hinbekommst. Wenn du doch fällst, nicht wieder einsteigen, sondern weiter zum nächsten Boulder. Wenn das gut funktionert, kannst du von vier auf fünf Boulder steigern. Wenn das easy wird, suche dir schwerere Boulder. Diese Übung kann 2 bis 3 mal wöchentlich für drei Wochen durchgeführt werden, danach widmet man sich dem Projekt. Nach einigen Wochen des schwer Kletterns sollte man dem Körper eine Erholungsphase von ein bis zwei Wochen gönnen, in denen man nicht oder deutlich leichter und deutlich weniger klettert als zuvor, damit der Körper sich von der Belastung des Trainings wieder erholen kann.
Boulderzirkel
Diese Variante der 4x4-Übung verzichtet auf die Pausen zwischen den Bouldern. Man bouldert, am besten an einer Definierwand, eine längere Strecke so schwer wie möglich. Wenn man keine konkrete Zug-Anzahl (aus dem eigenen Projekt) kennt, dann probiert man circa 24 harte Züge nacheinander zu bouldern. Die Intensität sollte so hoch sein, dass nachchalken nicht möglich ist. Diese Übung erfordert hohen Einsatz und trainiert damit auch die Einsatzbereitschaft fürs Projekt. Am besten nur im frischen Zustand durchführen. Zu Beginn vier Minuten Pause zwischen den Durchgängen, später reduzieren auf zwei. Wenn die Zugzahl bei 20 oder darunter liegt, 6 bis 8 Sätze, darüber 4 bis 6 Sätze. Auch für die Boulderzirkel gelten die oben genannten Zeitrahmen zur Durchführung, danach einer Performancephase von circa drei Wochen und danach einer Deloadphase.

Wie man die Finger auf die Belastung im Frankenjura vorbereiten kann
- Fingerboard
Trainiere verstärkt die offene Handhaltung und das Hängen an zwei Fingern. Dies ist sinnvoll fürs Klettern am fränkischen Kalk, da beim Halten von Fingerlöchern die Finger üblicherweise offen hängend agieren und nicht aufgestellt. Taste dich mit Entlastung (Pullysystem, Stuhl oder Deuserband) langsam an die optimale Intensität heran. Gehe nicht von null auf hundert, sondern gewöhne die Finger langsam, über Wochen, an die Belastung, besonders, wenn du sie bislang nicht gewöhnt bist. Je nach den Anforderungen im Projekt wählt man am Board Griffarten, die ähnlich sind.
Weitere Faktoren, die Pump minimieren können
- Weich greifen: Wer lernt, Griffe mit minimalem statt maximalem Kraftaufwand zu greifen, spart Energie.
- Atmen: Bei pressigen Zügen weiter zu atmen, oder auch die Atmung zu nutzen, um am Ruhepunkt schnell wieder locker und entspannt zu werden, kann einen großen Unterschied machen. Atme wann immer möglich durch die Nase.
- Entspannen: Wer besser und schneller entspannen kann, kommt am Ruhepunkt schneller zurück in den grünen Bereich. Entspannungsfähigkeit ist auch trainierbar.
- Klettertechnik: Im Frankenjura kann man oft mit etwas Krafteinsatz schwierige Stellen meistern. Wer eine gute Technik anwendet und die optimale Körperposition findet, braucht allerdings weniger Kraft.
- Ruhepunkte nutzen: Je mehr du übst, dich an guten, mittleren und auch bescheidenen Ruhepunkten zu erholen, desto besser wirst du dies auch am Fels umsetzen können.
Mehr:






