Und doch werden in der Frostsaison wieder Hunderte mit Eisgeräten und Steigeisen bewaffnet durch die Alpen pilgern, um dort dem Klettern in kältestarren Wasserfällen zu frönen.
Eisklettern: Weil es kalt ist. Weil es nass ist. Und auch, weil es so ziemlich das Letzte ist, was normale Menschen im Winter tun wollen.
Eisliebhaber finden in den Steilstufen und Schluchten eine Herausforderung, die noch nicht genormt ist. Die nur den Regeln der Natur unterliegt. Eisklettern ist kein einfaches Konsumvergnügen.

Eisklettern ist ein ernsthaftes Spiel in einer faszinierend anderen Umgebung, wo senkrecht sich noch wie senkrecht anfühlt. Auch wenn es in den unteren Graden klettertechnisch gar nicht so anspruchsvoll ist: Das Selbstabsichern, das Einschätzen der Verhältnisse, die Planung von Zu- und Abstieg, der Aufenthalt im Gebirge – all das garantiert Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Und deshalb ist Eisklettern der Hit.
Auf den nächsten Seiten: Risikofaktoren beim Eisklettern - wie man das Eis einschätzen kann
Im festen Zustand?

Mal ist es hellblau und kompakt, mal röhrig und weiß. Mal klebt es offenbar absturzbereit an der Wand, mal bildet es einen massiven Vorhang: In gefrorenen Wasserfällen kann das Eis ganz verschiedene Formen, Farben und Konsistenzen haben. Diese Verspieltheit der Natur macht für viele Eiskletterer den Reiz an der Sache aus, denn zum reinen Klettern kommt eben dazu, dass der Eisfall jedes Jahr (oder jede Woche) anders aussieht und immer wieder neu eingeschätzt und verstanden werden muss. Die Eisverhältnisse spielen beim Beklettern solcher Gebilde in vielerlei Hinsicht eine Rolle: Sie bestimmen den Routenverlauf, die Schwierigkeit, die Gefährlichkeit einer Route.
Eisqualität beurteilen

Die wichtigste Voraussetzung bei der Begehung eines Eisfalls ist, dass der Fall beim Klettern nicht einstürzt. Dabei ist zunächst die Form des Eisfalls zu beachten. Im Grundsatz gilt: Je weniger Felskontakt das Eis hat und je dünner es ist, desto fragiler. Auf der nächsten Seite findet ihr eine Typisierung von Wasserfällen, denen grundsätzlich auch ein unterschiedliches Risiko zugeordnet werden kann. Natürlich sind freihängende Zapfen dabei die zerbrechlichsten Gebilde, an die sich nur sehr erfahrene Eisgeher bei besten Bedingungen trauen sollten. Aber auch bei freistehenden Säulen ist großes Misstrauen angebracht. Oft fußen sie auf sogenanntem Blumenkohleis, das herabtropfendem Wasser gebildet wird. Blumenkohleis weist viele Lufteinschlüsse auf, ist schwierig zu beklettern und abzusichern und hat zudem noch den Nachteil, dass es als Sockel einer Eissäule eigentlich nicht sonderlich geeignet ist: Es hat eine schlechte innere Eisqualität. Je dicker eine solche Säule ist, desto stabiler steht sie zunächst. Säulen, die oben bereits angerissen sind, sollte man aber auf jeden Fall aus dem Weg gehen.
Richtig gutes und stabiles Eis findet sich meist in Rinnen und an Steilstufen. Hier weist das Eis die größte Dichte auf und ist blau bis hellblau. Weißes, milchiges Eis dagegen lässt auf sehr nasses, mehrmals aufgetautes und weiches Softeis schließen. Auch von Eis überzogene Neuschnee-Einschlüsse schimmern meist weiß. Generell lässt weißes Eis auf Schnee, Lufteinschlüsse und Röhreneis schließen, also auf eine schlechte Substanz.
Temperatur des Eises

Die Stabilität des Eisfalls hängt auch mit der Temperatur zusammen. Vor allem stark steigende Temperaturen muss der Eiskletterer fürchten, weil dann Eiszapfen abbrechen, und der gesamte Eisfall einbrechen kann. Im Laufe eines Winters können solche Zusammenbrüche eines Falls durch Erwärmung mehrfach vorkommen. Besonders die warmen Föhnwinde setzen dem Eis sehr schnell zu.
Aber auch extrem niedrige Temperaturen sind mit Vorsicht zu genießen: Das Eis wird beim Abkühlen zwar dichter, aber auch spröder. Bei fragilen Eissäulen oder freihängenden Zapfen wird es da schon extrem kitzelig, weil ein Sprödbruch droht. Dazu kommt, dass das Klettern im spröden Eis wenig Freude bereitet: Die Eisgeräte bringen das Eis zum Splittern und lösen große Schollen heraus (nicht direkt übereinander klettern!), sitzen aber erst nach mehrmaligem Einschlagen solide. Auch das Absichern macht größere Schwierigkeiten, weil Eisschrauben sprödes Eis leichter sprengen.
Die besten Verhältnisse herrschen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, wenn es tagsüber leicht über Null Grad hat, so dass die Eisoberfläche etwas antaut, und nachts einige Grade darunter. Das Eis wird dann elastisch, splittert weniger und lässt sich auch leichter absichern. Zu bedenken ist, dass sich die Eisverhältnisse bei Veränderungen der Lufttemperatur erst mit Verzögerung umstellen. Besonders in schattigen Rinnenlagen kann es nach extremen Frostperioden noch lange spröde und splittrig sein, auch wenn die Luft sich schon erwärmt hat.
Im Zweifel nicht
Wenn sich unter dem Eis Hohlräume gebildet haben und keine sichere Verbindung zum Untergrund mehr besteht, ist das auch beim Einschlagen des Eisgeräts zu hören: Es klingt dann dumpf und hohl. Ein sattes und vibrationsfreies Schmatzgeräusch bedeutet dagegen solides und weiches Kompakteis.
Eisfälle in der Sonne zu beklettern, ist in Kanada üblich. Dort ist es aber auch ein paar Grade kälter als in den Alpen. Im alpinen Eis sollte in der Sonne nur geklettert werden, wenn die Temperaturen wirklich niedrig sind (und das Eis im Schatten zu spröde ist). Wer sich in die Sonne traut, sollte bei der Routenwahl und der Einschätzung der Verhältnisse besonders sorgfältig sein. Zudem steigt bei Sonnenschein die Gefahr durch abbrechende Eiszapfen über oder neben der Route stark an. Eis ist ein faszinierende Medium, das aber mit dem nötigen Respekt angegangen werden will. Und im Zweifel gilt: Lieber einmal nicht einsteigen als Kopf und Kragen riskieren.
Auf der nächsten Seite: Lawinen-Informationen
Eisklettern und Lawinengefahr
Basiswissen Lawinen

Das Klettern an Eisfällen spielt sich im winterlichen Hochgebirge ab. Damit kann je nach Schneelage und Position des Eisfalls Lawinengefahr bestehen. Wirklich ungefährdet sind eigentlich nur die Fälle in bewaldeten Gebieten ohne darüber liegendes, größeres Lawinen-Einzugsgebiet. Die meisten Eiskletterführer geben bei den einzelnen Fällen Hinweise, wie stark lawinengefährdet sie sind.
Lawinen können sich beim Eisklettern sowohl im Zu- oder Abstieg lösen als auch von über dem Eisfall liegenden Hängen. Oft sind diese nicht direkt einsehbar. Über die Grundlagen der Lawinenkunde sollte man sich als Eiskletterer also auf jeden Fall schlau machen. Da dies ein sehr komplexes Thema ist, empfiehlt sich ein Lawinenkurs – oder ein erfahrener und kompetenter Begleiter im Eis.
Neben dem Schneedeckenaufbau spielen vor allem die Geländeformen (Neigung, Exposition, Hanggröße) und die Witterung (Temperatur, Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Wind) eine wichtige Rolle, dazu im Fall der Begehung von verschneiten Hängen auch der Faktor Mensch (Belastung des Hangs). Bei starkem Schneefall kann sogar herabfallender Lockerschnee (Spindrift) von kleinen Flachstellen im oder überm Eisfall gefährlich werden.
Lawinen vermeiden
Die wichtigste Grundlage zur Beurteilung der Lawinengefahr stellt heutzutage der Lawinenlagebericht dar. Er erläutert die Gefahrstufen (es gibt fünf davon) und gibt Hinweise, welche Hänge, Expositionen und Höhenlagen besonders gefährdet sind. Um die eher großräumigen Infos des Lageberichts mit der Situation vor Ort zu verknüpfen und darauf aufbauend Entscheidungsstrategien (Gehen oder nicht? Falls ja, wohin?) zu entwickeln, gibt es vom Deutschen Alpenverein die sogenannte „Snowcard“ und die „Gefahrenampel“. Beim OEAV setzt man auf den „Stop or go“-Check, in der Schweiz hat Lawinenexperte Werner Munter die Entscheidungsstrategie gar auf einem Bierdeckel zusammengefasst. Mit einer dieser Entscheidungshilfen sollte sich der Eiskletterer auf jeden Fall vertraut machen.
Und da die Eisfälle oft über die Entwässerungsrinnen größerer Hänge verlaufen, gehört auch das Kartenstudium vor dem Eisklettern im Hochgebirge zum Pflichtprogramm. So wie auch eine Portion Respekt gegenüber den winterlichen Bergen.
Auf der nächsten Seite: Die verschiedenen Formen von Eisfällen und ihr jeweiliges Risiko
Weitere Artikel:
Die verschiedenen Eistypen - Formklassen
Je nach Formklasse sind die Eisfälle mehr oder weniger stabil oder einsturzgefährdet. (Klick auf die Grafik öffnet die Großansicht)
Die Formklassen des Eises

Formklasse F1
Der Eisfall baut sich aus kompakten Eisschilden und runden Kuppen über einer Geländestufe auf. Der Großteil seines Eigengewichtes wird dabei direkt an die Fels- und Erdoberfläche abgegeben. Sollte das Eisgefüge einen Bruch erleiden, so stürzt das Gebilde nicht sofort ein, sondern stützt sich an den Fels und hält „in sich“ zusammen. Die größte Gefahr geht meist vom darüber liegenden Lawineneinzugsgebiet aus.
Formklasse F2
Steiles, gestuftes Gelände: Der Eisfall baut sich wiederum aus einem kompakten Schild auf. Aufgrund der Steilheit wird aber der Hauptanteil sämtlicher Lasten innerhalb des Eisfalles abgeleitet und erst am Fuße desselben auf die Erdoberfläche übertragen. Auch bei Eisfällen dieser Art ist ein Einsturz eher selten zu beobachten. Wenn, dann im Zusammenhang mit einem dauerhaften Anstieg der Temperatur und starkem Schmelzprozess an der Basis.
Formklasse F3
Der Eiskörper steht an vereinzelten Partien frei, hat aber an mehreren Stellen Kontakt zum Fels. Ein Temperaturanstieg und ein Anstieg der fließenden Wassermengen bewirken, dass der gestufte Wasserfall mit vereinzelt freistehenden Säulen an Stabilität verliert. Ab der Klasse F3 werden die Eisfälle brisant. Bei gravierendem Temperaturanstieg oder -abfall ist der Kletterer gut beraten, besondere Vorsicht walten zu lassen.
Formklasse F4
Freistehende Säulen wachsen, beginnend als freihängende Zapfen, von oben nach unten. Spritzwasser von oben bildet die Basis der Säule, welche sich meistens als Eiskegel ausbildet. Schließlich wachsen Eiszapfen und Eiskegel zusammen. Die Gebilde gleichen einem Kartenhaus. Sie reagieren auf zahlreiche Faktoren wie Temperaturveränderungen, auf Wind oder auch auf das Schmelzwasser, welches in ihnen und um sie herum abfließt, und können plötzlich zum Einsturz kommen.
Formklasse F5
Die Stabilität eines Eiszapfens hängt primär von seiner Größe und der Befestigungsfläche zum Fels ab, in der sämtliche Zugkräfte aufgenommen werden müssen. Eiszapfen reagieren sehr schnell auf Temperaturanstiege und besonders rasch auf direkte Sonneneinstrahlung. Eiszapfen sind als sehr labil und riskant einzustufen.
Auf der nächsten Seite: Literaturtipps und Termine rund ums Eisklettern
Eisklettern: Literatur & Termine 2011
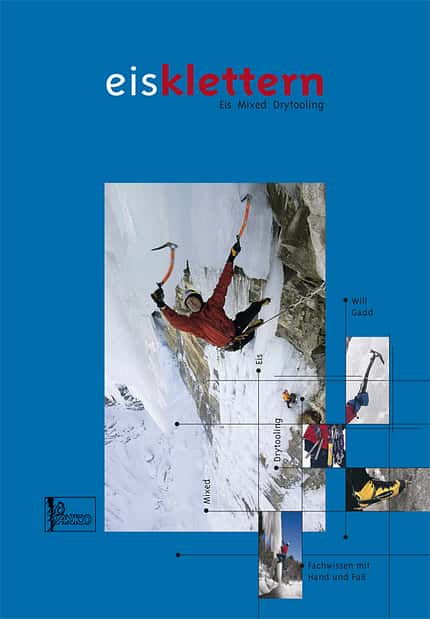
Eisklettern – Eis, Mixed, Drytooling
Will Gadds Standardwerk umfasst fast alles, was es zum modernen Eis- und Mixedklettern zu wissen gibt. Das reich bebilderte Buch ist 2006 beim Panico Alpinverlag erschienen, erhältlich im klettern-shop, 24,80 €
Auszug aus Will Gadds Buch: Die Grundtechniken beim Eisklettern
"Eisklettern - Eis Mixed Drytooling" von Will Gadd direkt hier im klettern-Shop bestellen
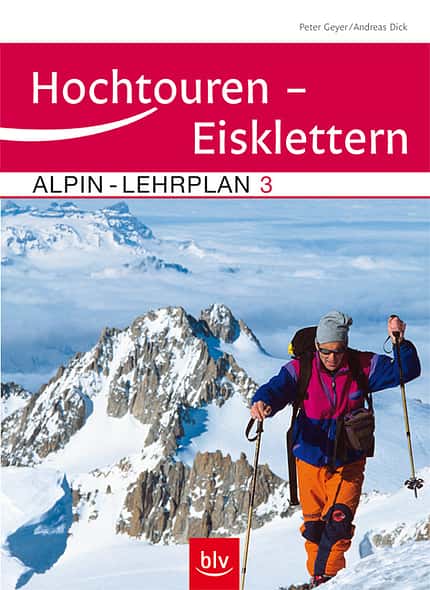
Alpinlehrplan Hochtouren – Eisklettern
In Band 3 des Alpin-Lehrplans aus dem Jahr 2008 schildern Peter Geyer und Andi Dick, beide Berg- und Skiführer, stark bebildert Eis- und Mixedklettertechniken und vieles mehr. BLV Buchverlag, 28,00 €.
DVD: Faszination Eisklettern
Von den ersten Schritten ins Eis über Toprope-Übungen bis hin zum effektiven Klettern in Zweier- und Dreierseilschaft liefert die DVD von Franz Karger ausführliche Erklärungen und anschauliches Bildmaterial zum Thema. Die DVD kann unter www.bergfuehrer.at/kaernten bestellt werden (ohne Abbildung).
Termine rund ums Eis
- 29. - 30.1.2011 Ice fight,
Rabenstein, Italien
Am Eisturm in Rabenstein im Passeier Tal, Südtirol, steigt zum dritten Mal der Ice Fight, ein internationaler Wettkampf. Zudem ist der Eisturm den ganzen Winter für Jedermann zugänglich. www.eisklettern.it
- 5. - 6.2.2011 UIAA Worldcup Ice Climbing, WM Lead,
Busteni, Rumänien
Busteni in Rumänien hat als Station des Eisweltcups schon Tradition. Anfang Februar wird ein Weltcup im Speed und zeitgleich die Weltmeisterschaft im Lead ausgetragen. www.theuiaa.org; www.iwcbusteni.ro
- 12.2.2011 Coldfinger,
Fieberbrunn (Europacup), Österreich
Der Wettkampf in Fieberbrunn in Tirol ist nach dem Drytooling-Wettkampf Anfang November in Innsbruck die zweite Station der Europacup-Wertung.
www.coldfinger.at
- 12. - 13.2.2011 Knuckle Basher Festival,
Canmore, Kanada
Auch in Kanada kann man sich im Rahmen eines Festivals die Knöchel anschlagen und gemeinsam mit der dortigen Szene Spaß haben. Eisfälle gibt dazu es rings um Canmore mehr als genug. www.knucklebasher.com
- 18. - 20.2.2011 Glace Glisse,
Heutal, Unken, Österreich (Europacup)
Der Wettkampf in einem Seitental des Saalachtals südwestlich von Salzburg geht in die zweite Runde und ist zugleich das Finale der Europacup-Wertung. Auch hier gibt‘s natürlich wieder Vorträe und eine Party. www.glace-glisse.com
- 6. - 8.3.2011 UIAA Worldcup Ice Climbing, WM speed,
Kirov, Russland
Auch Kirov knüpft in diesem Winter wieder an seine Tradition als Austragungsort eines Eisweltcups an. Hier werden ein Weltcup im Lead und zeitgleich die Weltmeisterschaft im Speed ausgetragen. www.theuiaa.org;
Weitere Artikel:






